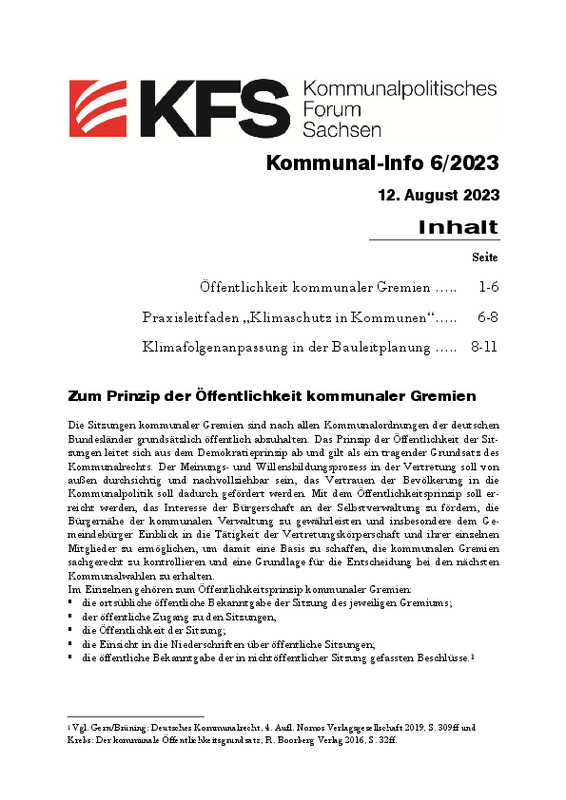Die Sitzungen kommunaler Gremien sind nach allen Kommunalordnungen der deutschen Bundesländer grundsätzlich öffentlich abzuhalten. Das Prinzip der Öffentlichkeit der Sitzungen leitet sich aus dem Demokratieprinzip ab und gilt als ein tragender Grundsatz des Kommunalrechts. Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Vertretung soll von außen durchsichtig und nachvollziehbar sein, das Vertrauen der Bevölkerung in die Kommunalpolitik soll dadurch gefördert werden. Mit dem Öffentlichkeitsprinzip soll erreicht werden, das Interesse der Bürgerschaft an der Selbstverwaltung zu fördern, die Bürgernähe der kommunalen Verwaltung zu gewährleisten und insbesondere dem Gemeindebürger Einblick in die Tätigkeit der Vertretungskörperschaft und ihrer einzelnen Mitglieder zu ermöglichen, um damit eine Basis zu schaffen, die kommunalen Gremien sachgerecht zu kontrollieren und eine Grundlage für die Entscheidung bei den nächsten Kommunalwahlen zu erhalten.
Im Einzelnen gehören zum Öffentlichkeitsprinzip kommunaler Gremien:
die ortsübliche öffentliche Bekanntgabe der Sitzung des jeweiligen Gremiums;
der öffentliche Zugang zu den Sitzungen,
die Öffentlichkeit der Sitzung;
die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen;
die öffentliche Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse.
Öffentliche oder nichtöffentliche Sitzung
Gemäß der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) bzw. der Sächsischen Landkreisordnung (SächsLKrO) sind Sitzungen des Gemeinderats bzw. des Kreistags öffentlich, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner eine nichtöffentliche Verhandlung erfordern. Gleiches gilt nach dem Sächsischen Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (SächKomZG) ebenso für die Verbandsversammlungen von Verwaltungsverbänden und Zweckverbänden sowie die Gemeinschaftsausschüsse von Verwaltungsgemeinschaften.
Im Einzelnen sind danach grundsätzlich öffentlich durchzuführen:
die Gemeinderats- und Kreistagssitzungen;
die Sitzungen von Verbandsversammlungen von Verwaltungs- und Zweckverbänden sowie der Gemeinschaftsausschüsse von Verwaltungsgemeinschaften;
die Sitzungen Beschließender Ausschüsse.
Nichtöffentliche Sitzungen finden statt:
wenn das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner tangiert werden;
bei den Beratenden Ausschüssen;
in der Regel bei der Vorberatung von Gegenständen für die Gemeinderats- bzw. Kreistagssitzung durch einen Beschließenden Ausschuss;
in den Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) der privatrechtlich organisierten Unternehmen (GmbH, Aktiengesellschaft) an denen die Gemeinde oder der Landkreis beteiligt sind.
Die Vorberatung von Angelegenheiten durch Beschließende Ausschüsse erfolgt in der Regel nichtöffentlich, was heißt, das im Einzelfall das Ermessen besteht, auch mal die Öffentlichkeit zuzulassen. Beratende Ausschüsse tagen stets nichtöffentlich, hier besteht deshalb keine Möglichkeit, per Beschluss im Ausnahmefall mal die Öffentlichkeit zu zuzulassen.
Öffentlicher Zugang zu den Sitzungen
Während der gesamten Dauer der öffentlichen Sitzung ist jedermann und -frau der freie Zutritt zum Sitzungsraum zu ermöglichen. Unzulässig wäre es etwa, verspätet eintreffende Besucher vor geschlossener Tür abzuweisen. Da jedermann und -frau der Zutritt zu gewähren ist, wäre es auch unzulässig, bestimmte Personengruppen wie Ortsfremde oder von einem Tagesordnungspunkt besonders Betroffene von vornherein von der Sitzung auszuschließen. Umgekehrt wäre es auch unzulässig, bei angenommenen starkem Besucherandrang den Zugang nur bestimmten Personengruppen einzuräumen. Unbedenklich hingegen ist die allgemeine Praxis, den üblicherweise teilnehmenden Pressevertretern ausgewiesene Plätze zu reservieren.
Werden Personen, die die Sitzung stören, durch Wahrnehmung des Hausrechts des Sitzungsraums verwiesen, bedeutet das keine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes, da Zuhörer den Sitzungsablauf nicht beeinträchtigen dürfen und abgesehen von einer Fragestunde auf eine passive Teilnahme beschränkt sind.
Der Sitzungsraum muss sich nicht in einem gemeinde- bzw. kreiseigenem Gebäude befinden, muss aber allgemein zugänglich sein und Bürgermeister bzw. Landrat müssen für die Dauer der Sitzung die Ordnungsgewalt und das Hausrecht ausüben können. Die Sitzungen haben grundsätzlich im jeweiligen territorialen Siedlungsgebiet stattzufinden. Eine Gemeinderatssitzung z.B. außerhalb des Gemeindegebiets entspräche nicht dem Öffentlichkeitsprinzip, widerspräche seinem demokratischen Anliegen, die Gemeindebürger und -bürgerinnen in die kommunale Selbstverwaltung einzubeziehen.
Der Sitzungsraum muss nicht jedem Andrang gewachsen sein, ausreichend ist ein Platzangebot, das dem gängigen Interesse an Sitzungen entspricht. Bei übermäßigen Andrang ist es zulässig, den Zugang zu beschränken und ggf. durch die Ausgabe von Einlasskarten zu steuern, ohne dabei bestimmte Personen oder Personengruppen zu bevorzugen. Sollte der Sitzungsraum tatsächlich mal überfüllt sein, kann ihn der oder die Vorsitzende kraft ihrer Ordnungsgewalt für weitere Zuhörer sperren.
Aus dem Öffentlichkeitsgrundsatz leitet sich für die Zuhörer keine Berechtigung zu Tonband- oder Bildaufzeichnungen ab, was ebenso für Pressevertreter gilt. »Zulässig sind… Aufzeichnungen, die mit dem Einverständnis der Betroffenen gemacht werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bei Bildaufzeichnungen nicht nur der aktuelle Redner, sondern auch weitere Gemeinderatsmitglieder erfasst werden können, deren Persönlichkeitsrechte berührt werden können. Erforderlich ist deshalb stets der Zustimmung aller Gemeinderatsmitglieder, eine Mehrheitsentscheidung des Gemeinderats genügt deshalb nicht. Dies gilt insbesondere auch für eine Live-Übertragung von öffentlichen Gemeinderatssitzungen; ein zustimmender Beschluss des Gemeinderats oder auch eine entsprechende Regelung in der Geschäftsordnung sind insoweit nicht ausreichend.«
Öffentlichkeit der Sitzung
Der Öffentlichkeitsgrundsatz verlangt einen öffentlichen Verhandlungsgang, zu dem eine öffentliche Aussprache (Debatte) zu den Verhandlungsgegenständen sowie eine offene Stimmabgabe gehören. Eine Abstimmung in Gemeinderat oder Kreistag zu einer Sache ohne vorherige Aussprache zur selben würde nicht dem Öffentlichkeitsgrundsatz entsprechen, auch wenn darauf verwiesen wird, die Sache sei bereits ausgiebigst in entsprechenden Ausschüssen beredet worden.
Eine offene Aussprache zu einer Sache kann nicht durch einfache Verfahrensanträge (Antrag auf sofortige Abstimmung, Antrag auf Schluss der Aussprache) abgewürgt werden. Erst wenn in der laufenden Sitzung alle Argumente ausgetauscht worden sind, kann ein Schlussantrag gestellt werden. Gerade durch eine öffentliche Aussprache in Gemeinderat oder Kreistag als den Hauptorganen kommunaler Selbstverwaltung wird dem Anliegen des Öffentlichkeitsprinzips gerecht, den Meinungs- und Willensbildungsprozess für die Einwohner und Bürger nachvollziehbar zu machen. Wird allerdings zu einer Sache kein Redebedarf angemeldet, muss nicht zwingend eine Aussprache stattfinden und kann unmittelbar zur Abstimmung übergegangen werden.
Da seit der Kommunalrechtsänderung vom 9. Februar 2022 die Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen vorab zu veröffentlichen sind, können nunmehr die Besucher von Sitzungen sich über die in der Sitzung zu behandelnden und zu beschließenden Angelegenheiten informieren und können dem Geschehen nun besser folgen, wenn selbst keine öffentliche Debatte zu einer Angelegenheit stattfindet.
Die Abstimmungen in den öffentlichen Sitzungen haben grundsätzlich offen, für alle Anwesenden erkennbar, stattzufinden. Nur aus wichtigem Grund darf im äußersten Ausnahmefall geheim abgestimmt werden. »Das Gebot der offenen Stimmabgabe ist von erheblicher und grundsätzlicher Bedeutung für eine funktionierende, ,gesunde’ kommunale Demokratie. Der einzelne Gemeinderat ist gehalten, für jedermann erkennbar ,Farbe zu bekennen’ und zu seiner Überzeugung zu stehen. Auf diese Weise erhalten die Bürger die Möglichkeit, die Auffassungen ihrer gewählten Vertreter zu den einzelnen Sachentscheidungen zu erkennen.«
Ausschluss der Öffentlichkeit und nichtöffentliche Sitzung
Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen und die Beratung und Beschlussfassung kann in einer nichtöffentlichen Sitzung stattfinden, wenn
a) das öffentliche Wohl oder
b) berechtigte Interessen Einzelner
das erfordern.
Öffentliches Wohl
Gründe des öffentlichen Wohls sind gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, die auf eine Gefährdung der Interessen des Bundes, des Landes, der Gemeinde, anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder der örtlichen Gemeinschaft schließen lassen, auch wenn dies tatsächlich nicht eintreten muss. Solche Gründe bestehen jedenfalls dann, wenn durch gesetzliche Vorschriften Verschwiegenheit oder Geheimhaltung in bestimmten Angelegenheiten einzuhalten ist, z.B. beim Steuergeheimnis, in Sozialangelegenheiten, bei einzelstatistischen Daten sowie den Datenschutz berührende Informationen oder aus Gründen staatlicher Sicherheit und der Landesverteidigung. Auch bei Rechtsstreitigkeiten kann nichtöffentlich verhandelt werden, weil bei öffentlicher Behandlung möglicherweise der gegnerischen Seite Argumente offengelegt werden, die der Gemeinde zum Nachteil gereichen.
Berechtigte Interessen Einzelner
Berechtigte Interessen Einzelner sind rechtlich geschützte oder anerkannte Interessen, die auf rechtlich erlaubtes gerichtet sind. „Einzelne“ können sein: natürliche Personen, juristische Personen oder Personengruppen. Berechtigte Interessen einzelner liegen dann vor, wenn in der öffentlichen Verhandlung das Bekanntwerden persönlicher, wirtschaftlicher oder anderer Verhältnisse nachteilige Folgen für den einzelnen hätte, hinsichtlich seiner allgemeinen Wertschätzung, seiner privaten oder gesellschaftlichen Existenz und seinem weiteren Fortkommen. Für einen Ausschluss der Öffentlichkeit reicht es jedoch nicht aus, dass private Interessen allein schon tangiert werden. Sie müssen schon so gewichtig sein, dass es zu den tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen kommen kann und daher der Ausschluss der Öffentlichkeit erforderlich wird. Darunter fallen in der Regel Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Werturteile, Angaben über Einkommen und Vermögen, familiäre Verhältnisse, Vorstrafen, Bankgeheimnisse, Bedürftigkeitsfragen und Eignungsbewertungen.
Einzelfallprüfung und Abwägung
Bei der Aufstellung der Tagesordnung haben Bürgermeister bzw. Landrat eine Prüfung vorzunehmen, ob Gründe des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner für den konkreten Einzelfall vorliegen und mit dem für den Regelfall geltenden Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit abzuwägen. Es ist jedoch nicht zulässig, bestimmte Fallgruppen wie z.B. Grundstücksangelegenheiten oder Personalangelegenheiten von vornherein gänzlich von der Sitzungsöffentlichkeit auszunehmen.
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten gelten gemeinhin als Beratungs- und Beschlussgegenstände, die wegen berechtigter Interessen Einzelner grundsätzlich nicht öffentlich zu behandeln sind, da regelmäßig persönliche Belange, etwa die Fähigkeiten und Leistungen von Stellenbewerben oder Bediensteten, zur Sprache kommen. Aber Personalangelegenheiten sind »dann öffentlich zu verhandeln, wenn Personalsituationen allgemein thematisiert werden sollen, oder es um eine ganze Gruppe von Bediensteten geht, deren individuelle Verhältnisse nicht zum Verhandlungsgegenstand gemacht werden sollen. Ebenso können Vorstellungen und Wahlen von Beigeordneten, Dezernenten und ähnlich herausgehobenen Positionen innerhalb der Kommune grundsätzlich in öffentlicher Sitzung erfolgen; eine vertiefte Aussprache über die Persönlichkeit des Bewerbers mit seinen Stärken und Schwächen müsste hingegen nicht öffentlich geführt werden.«
Bei der Bestellung von Beigeordneten kommt dem Öffentlichkeitsgrundsatz sogar eine besondere Bedeutung zu, denn hier besteht bei der Entscheidung über die Besetzung der Stelle ein legitimes Interesse der Allgemeinheit, selbst die betreffenden Bewerber einschätzen zu können.
Grundstücksangelegenheiten
Grundstücksangelegenheiten unterliegen nicht generell dem Vorbehalt der Nichtöffentlichkeit. Ihre Behandlung in öffentlicher Sitzung kann im Interesse einer Durchschaubarkeit der Willensbildung in der Kommunalvertretung von besonderem, dem Gemeinwohl dienenden, allgemeinen Interesse sein. Andererseits ergeben sich auch Konstellationen, bei denen berechtigte Interessen Einzelner betroffen sein können. So gehören Kaufverträge über Grundstücke zu den Angelegenheiten, deren vertrauliche Behandlung im Interesse der Vertragspartner in Frage kommt. Eine vertrauliche Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung ist dann geboten, wenn in der Debatte die persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers bzw. Verkäufers zur Sprache kommen.
Bei der Ausübung eines gemeindlichen Vorkaufsrechts besteht grundsätzlich kein Gebot, nichtöffentlich zu verhandeln. Sollten in der Debatte aus besonderen Gründen persönliche oder wirtschaftliche Einzelangaben von Käufern wie etwa die Kreditwürdigkeit zur Sprache kommen, müsste in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt werden.
Ebenfalls hat die Behandlung von Bauvoranfragen und Bauanträgen in öffentlicher Sitzung zu erfolgen. Im Unterschied zu Verkauf, Vermietung oder zur Auftragsvergabe besteht keine Notwendigkeit, den Namen des Antragstellers zu nennen, weil es sich bei Vorbescheiden und Baugenehmigungen um rein objektbezogene Entscheidungen handelt, für die die persönlichen Verhältnisse der Antragstellen ohne jede Bedeutung sind.
Vergabeangelegenheiten
»Die Vergabe von Aufträgen erfolgt ebenfalls grundsätzlich in öffentlicher Sitzung. Die Geheimhaltungsvorschriften der Verdingungsordnungen treten hinter den Vorschriften der Gemeindeordnung zurück. Allein die Bekanntgabe der Angebotsummen der einzelnen Bieter rechtfertigen eine nichtöffentliche Verhandlung nicht.«
Werden jedoch vertrauliche betriebsinterne Angelegenheiten, Kalkulationsgrundlagen oder Fragen der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Bietern erörtert, hat das in nichtöffentlicher Sitzung zu geschehen.
Rechtsfolgen bei Verstoß gegen das Öffentlichkeitsprinzip
Aufgrund seiner zentralen Bedeutung ist das Prinzip der Sitzungsöffentlichkeit eine zwingende Verfahrensvorschrift. Wurden Beschlüsse gefasst, bei denen gegen das Öffentlichkeitsprinzip verstoßen wurde, sind diese rechtswidrig und damit unwirksam. »Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnder Tagesordnungspunkt fälschlich im öffentlichen Teil behandelt wurde, oder ob die Behandlung in nichtöffentlicher statt in öffentlicher Sitzung erfolgt ist.«
Text: Achim Grunke