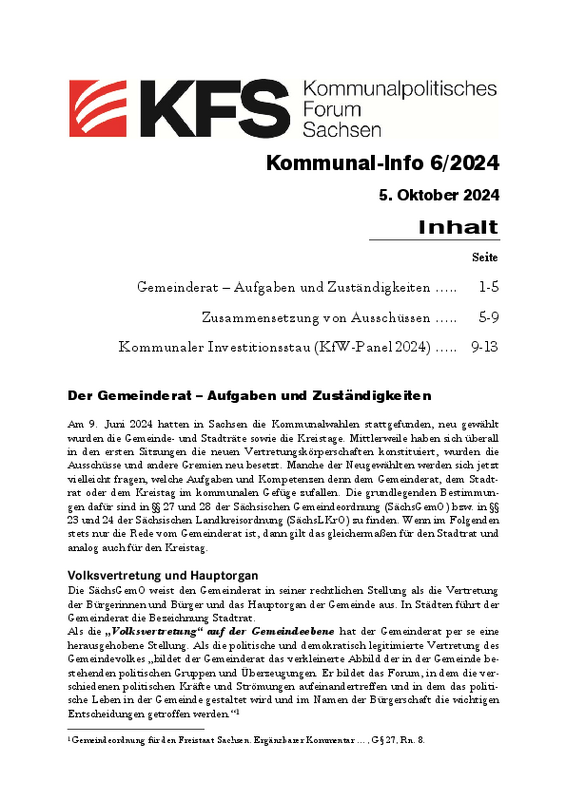Am 9. Juni 2024 hatten in Sachsen die Kommunalwahlen stattgefunden, neu gewählt wurden die Gemeinde- und Stadträte sowie die Kreistage. Mittlerweile haben sich überall in den ersten Sitzungen die neuen Vertretungskörperschaften konstituiert, wurden die Ausschüsse und andere Gremien neu besetzt. Manche der Neugewählten werden sich jetzt vielleicht fragen, welche Aufgaben und Kompetenzen denn dem Gemeinderat, dem Stadtrat oder dem Kreistag im kommunalen Gefüge zufallen. Die grundlegenden Bestimmungen dafür sind in §§ 27 und 28 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) bzw. in §§ 23 und 24 der Sächsischen Landkreisordnung (SächsLKrO) zu finden. Wenn im Folgenden stets nur die Rede vom Gemeinderat ist, dann gilt das gleichermaßen für den Stadtrat und analog auch für den Kreistag.
Volksvertretung und Hauptorgan
Die SächsGemO weist den Gemeinderat in seiner rechtlichen Stellung als die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde aus. In Städten führt der Gemeinderat die Bezeichnung Stadtrat.
Als die „Volksvertretung“ auf der Gemeindeebene hat der Gemeinderat per se eine herausgehobene Stellung. Als die politische und demokratisch legitimierte Vertretung des Gemeindevolkes „bildet der Gemeinderat das verkleinerte Abbild der in der Gemeinde bestehenden politischen Gruppen und Überzeugungen. Er bildet das Forum, in dem die verschiedenen politischen Kräfte und Strömungen aufeinandertreffen und in dem das politische Leben in der Gemeinde gestaltet wird und im Namen der Bürgerschaft die wichtigen Entscheidungen getroffen werden.“
Die verfassungsrechtliche Grundlage dafür ist in Artikel 28 des Grundgesetzes zu finden, wo bestimmt wird, dass das Volk in den Gemeinden wie in den Landkreisen eine Vertretung haben muss, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Von der im Grundgesetz und der Sächsischen Verfassung vorgesehenen Möglichkeit, dass in kleineren Gemeinden an die Stelle einer gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung treten kann, wurde in der SächsGemO keine entsprechende Regelung getroffen und ist damit in der kommunalen Praxis nicht vorgesehen.
In der Gemeinde als einer Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts bestehen zwei Organe: der Gemeinderat und der Bürgermeister. Dabei ist der Gemeinderat als Vertretung der Bürger auch das Hauptorgan der Gemeinde. Als Hauptorgan der Gemeinde kommt ihm eine kommunalpolitische Vorrangstellung zu: er ist das zentrale Entscheidungsgremium der Gemeinde und bestimmt die „Richtlinien der Gemeindepolitik“. Seinen gesetzlichen Niederschlag findet das in den unter § 28 SächsGemO dem Gemeinderat zugewiesenen Aufgaben, insbesondere:
der Zuständigkeitsvermutung für alle Aufgaben, soweit dafür nicht der Bürgermeister zuständig ist;
der Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde;
den Überwachungs- und Kontrollrechten: Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister;
den Mitwirkungsrechten bei Personalentscheidungen: so entscheidet der Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung der Gemeindebediensteten sowie über die Festsetzung von Vergütungen, auf die kein Anspruch auf Grund eines Tarifvertrags besteht.
Gemeinderat kein »Parlament«
Der Gemeinderat stellt zwar die gewählte Vertretung des Volkes in den Gemeinden dar, ist aber dennoch kein Parlament im staatsrechtlichen Sinne. Auch wenn umgangssprachlich häufig von „Kommunalparlamenten“ die Rede ist und die gewählten Mitglieder kommunaler Vertretungen als „Kommunalabgeordnete“ bezeichnet werden, ist das im staatsrechtrechtlichen Sinne dennoch nicht korrekt.
Der Gemeinderat ist deshalb kein Parlament, weil er kein Gesetzgebungsorgan ist, das im System der Gewaltenteilung neben den Organen der Exekutive und der Judikative steht. Der Gemeinderat ist Organ einer Selbstverwaltungskörperschaft, die insgesamt zur Exekutive zählt und damit auch bei der Rechtssetzungstätigkeit im System der staatlichen Gewaltenteilung dem Bereich der Verwaltung und nicht der Gesetzgebung zuzuordnen ist.
Im Unterschied zu Bundestag und Landtag steht beim Gemeinderat das Verwaltungshandeln im Vordergrund. Dagegen sind Bundestag und Landtag als klassische Legislativorgane nur in Ausnahmefällen mit verwaltenden Aufgaben befasst. Der Gemeinderat, der das den Gemeinden durch Gesetz verliehene Satzungsrecht ausübt, wird hierdurch nicht zum Legislativorgan. Die Befassungskompetenz des Gemeinderates ist eben nur auf Angelegenheiten des gemeindlichen Wirkungskreises beschränkt.
Die fehlende Parlamentseigenschaft des Gemeinderats kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Tätigkeit der Gemeinden durch die Rechtsaufsichtsbehörden des Freistaates überwacht wird (Artikel 89, Absatz 1 Sächsische Verfassung, § 111 SächsGemO), die ein Teil der Exekutive sind. Für Landtag und Bundestag hingegen wäre es völlig undenkbar, dass sie von einem Organ der Exekutive unter Aufsicht gestellt würden.
Aufgabenkatalog des Gemeinderats
Von erheblicher Bedeutung für die herausgehobene Stellung des Gemeinderats sind die in § 28 Absatz 2 SächsGemO in 21 Punkten aufgezählten Angelegenheiten, die allein in die Entscheidungszuständigkeit des Gemeinderats fallen. Die in diesem Katalog genannten Aufgaben dürfen weder auf einen Ausschuss noch auf den Bürgermeister übertragen werden:
die Festlegung von Grundsätzen für die Verwaltung der Gemeinde,
die Bestellung der Mitglieder von Ausschüssen des Gemeinderats, der Stellvertreter des Bürgermeisters, der Beigeordneten…,
die Übernahme freiwilliger Aufgaben,
Satzungen, anderes Ortsrecht und Flächennutzungspläne,
die Änderung des Gemeindegebietes,
die Entscheidung über die Durchführung eines Bürgerentscheides oder die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens,
die Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts,
die Regelung der allgemeinen Rechtsverhältnisse der Gemeindebediensteten,
die Übertragung von Aufgaben auf den Bürgermeister,
die Erteilung des Einvernehmens zur Abgrenzung der Geschäftskreise der Beigeordneten,
die Übertragung von Aufgaben auf das Rechnungsprüfungsamt,
der Entzug der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes…,
die Entscheidung der Auswahl des örtlichen Prüfers…,
die Verfügung über Gemeindevermögen, das für die Gemeinde von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist,
die Errichtung, Übernahme, wesentliche Veränderung, vollständige oder teilweise Veräußerung und die Auflösung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen sowie die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an solchen,
ein Haushaltsstrukturkonzept,
die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften und von Verpflichtungen aus Gewährverträgen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, soweit sie für die Gemeinden von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind,
Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Treuhandvermögen,
die allgemeine Festsetzung von Abgaben,
den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit sie für die Gemeinde von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind,
den Beitritt zu Zweckverbänden und den Austritt aus diesen.
Bei den in dem Katalog aufgezählten Aufgaben handelt es sich um solche, die nicht nur im konkreten Einzelfall, sondern ganz generell für die Gemeinde von herausragender Bedeutung. Daher obliegt die Entscheidung darüber dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde.
Festlegung der Grundsätze der Gemeindepolitik
Nach § 28 Absatz 1 SächsGemO bestimmt der Gemeinderat die Richtlinien der Gemeindepolitik, indem er die „Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde“ festlegt. Was darunter zu verstehen ist, wird in der SächsGemO nicht näher bestimmt.
„Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinderats müssen einerseits weit genug sein, damit der Gemeinderat seine Stellung als Führungsorgan erfüllen kann… Schließlich ist bei der Abwägung zu berücksichtigen, dass auch Gemeindepolitik in ihren Grundzügen einheitlich gestaltet werden muss und nicht durch unterschiedliche planerische oder konzeptionelle Vorstellungen zerrieben werden darf. Zu den Verwaltungsgrundsätzen zählen folglich die grundsätzlichen Leitlinien, mit denen der Gemeinderat Vorgaben über Programm, Planung und Gestaltung des Gemeindehandelns macht, und mit denen er seine grundsätzlichen kommunalpolitischen Zielsetzungen definiert.“
Beispiele für solche Richtlinien sind
konzeptionelle Planungen für die Stadtentwicklung und den Stadtumbau;
Richtlinien für die Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen an bestimmte, zu bevorzugende Personengruppen;
Grundsätze für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Kriterien für die Vermietung gemeindeeigener Versammlungsräume.
Die kommunalpolitische Steuerungskompetenz des Gemeinderats zeigt sich außerdem
in der ausschließlichen Zuständigkeit für die Beschlussfassung über den Gemeindehaushalt (§ 76 Absatz 2 SächsGemO)
und die Finanzplanung der Gemeinde (§ 80 SächsGemO).
Der Haushalt als die „in Zahlen gefasste Politik“ enthält vielfache Bindungen und Festlegungen für das künftige gemeindliche Handeln.
Der Bürgermeister hat die vom Gemeinderat aufgestellten „Grundsätze für die Verwaltung“ zu beachten und ist insoweit in seiner Befugnis zur Leitung der Geschäfte eingeschränkt. Umgekehrt darf der Gemeinderat dem Bürgermeister auch keine Einzelweisungen in dessen Zuständigkeitsbereich erteilen. Ein solches Eingriffsrecht ist mit der Grundsatzkompetenz im Wortsinne unvereinbar und widerspricht der innergemeindlichen Kompetenzverteilung und Machtbalance zwischen Gemeinderat und Bürgermeister. Ebenso besitzt der Gemeinderat keine innere Organisationsbefugnis. Hierzu zählen u.a. die Gliederung der Gemeindeverwaltung, der Geschäftsverteilungsplan und die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Ebenso obliegt allein dem Bürgermeister die Erledigung der Weisungsaufgaben nach § 2 Absatz 3 SächsGemO.
Überwachungs- und Kontrollfunktion
Mit der in § 28 Absatz 3 SächsGemO eingeräumten Überwachungs- und Kontrollfunktion soll sichergestellt werden, dass der Wille des Gemeinderats unverfälscht vollzogen wird. Die Überwachungsfunktion des Gemeinderats umfasst die Überwachung des Vollzugs der Gemeinderatsbeschlüsse und die Sorge für die Beseitigung von Missständen.
Angelegenheiten, die der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit erledigt (z.B. Weisungsaufgaben) unterliegen keiner Überwachung durch den Gemeinderat, es sei denn, es liegen Missstände in der Verwaltung vor. Das Kontrollrecht umfasst auch die dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Zuständigkeiten und schließt selbst Zweckmäßigkeitsentscheidungen ein, wenn diese zu Missständen führen oder geführt haben.
Treten Missstände auf, hat der Gemeinderat dafür zu sorgen, dass diese durch den Bürgermeister beseitigt werden. Ein Missstand liegt dann vor, wenn
gesetzliche Vorschriften verletzt werden oder
absolut unzweckmäßige Entscheidungen getroffen werden oder
gegen die kommunalpolitischen Richtlinien verstoßen wird oder
das Fehlverhalten von Mitarbeitern eine ordnungsmäßige Geschäftsabwicklung in Frage stellt.
„Ein Missstand ist gegeben, wenn die ordnungsgemäße Abwicklung der gemeindlichen Aufgaben und der ordnungsgemäße Gang der Verwaltungsgeschäfte nicht gegeben ist und damit negative Auswirkungen auf das gemeindliche Leben verbunden sind. Es ist nicht erforderlich, dass die Verwaltung insgesamt in Unordnung geraten ist. Mängel hinsichtlich bestimmter Aufgabengebiete oder einzelner Angelegenheiten genügen. Diese Mängel können darauf beruhen, dass der Bürgermeister wiederholt oder in schwerwiegender Weise gegen gesetzliche Bestimmungen (bei Weisungsaufgaben auch gegen rechtmäßig ergangene Weisungen der Rechtsaufsichtsbehörde) verstößt, bei der Ausübung seines Ermessens offensichtlich fehlsame Entscheidungen trifft oder Entscheidungen trifft, die offenkundig unzweckmäßig sind, aber auch, dass er ein eigentlich angezeigtes Handeln unterlässt oder die Gemeindebediensteten nicht in der gebotenen Weise beaufsichtigt. Der Verstoß muss von Gewicht und einer gewissen Nachhaltigkeit sein. Einmalige oder geringfügige Verstöße stellen keinen Missstand dar. Ebenso kann der Gemeinderat eine Entscheidung des Bürgermeisters nicht allein deshalb rügen, weil er ein anderes Vorgehen für zweckmäßiger erachtet hätte.“
Einflussnahme bei Personalentscheidungen
Wichtige personalrechtlichen Entscheidungen wie die Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung der Gemeindebediensteten werden einvernehmlich zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat getroffen.
Das Einvernehmen wird in der Regel herbeigeführt, indem der Bürgermeister eine Beschlussvorlage unterbreitet, die der Gemeinderat billigt, oder der Gemeinderat aus dem Kreis der in Betracht kommenden Bewerber eine Person auswählt und den Bürgermeister zur Zustimmung auffordert. Ebenso kann der Gemeinderat dem Bürgermeister auch eine Vorauswahl überlassen und sodann aus dem vom Bürgermeister vorweg gebilligten Personenkreis seine Entscheidung treffen.
Die Erteilung des Einvernehmens muss vom Bürgermeister als Organ erfolgen, kann nicht durch einen Beigeordneten vollzogen werden. Im Falle der Verhinderung des Bürgermeisters ist der allgemeine Stellvertreter zuständig.
Kommt das notwendige Einvernehmen nicht zustande, entscheidet der Gemeinderat, wobei eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich ist (die Stimme des Bürgermeisters mit eingerechnet). Eine nochmalige Entscheidung des Gemeinderats ist auch dann erforderlich, wenn der Gemeinderat bereits seine Wahl mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen haben sollte, der der Bürgermeister seine Zustimmung versagt hat. Kommen weder ein Einvernehmen noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande, kann die geplante Personalmaßnahme nicht getroffen werden.
Text: Achim Grunke
Rechsquellen: §§ 27, 28 SächsGemO bzw. §§ 23, 24 SächsLKrO